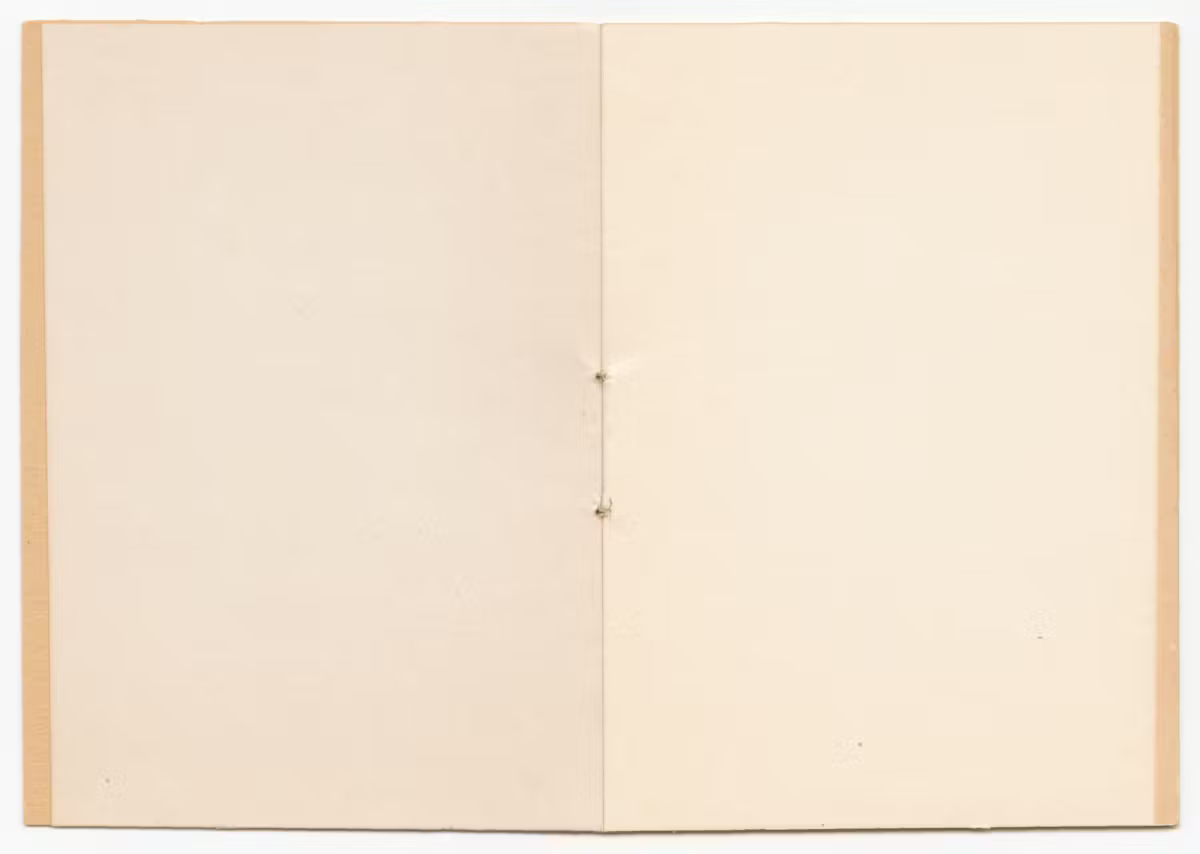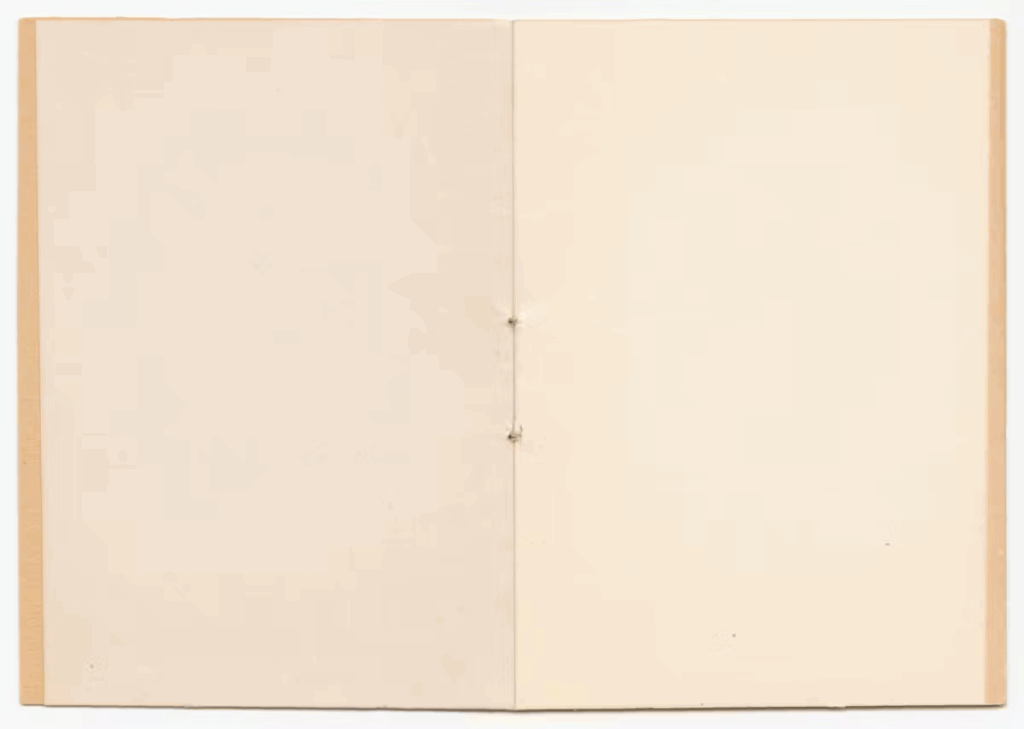
Man kann sich Wahlen als gelöstes Problem vorstellen: Stift, Papier und Urne gewährleisten Gleichheit und Geheimnis der Wahl gem. Art. 38 GG, tausende von Menschen stellen anschließend das Wahlergebnis fest und minimieren so die Manipulierbarkeit der Wahl. Die abgegebenen Stimmen liegen physisch vor und können gegebenenfalls nachgezählt werden. Das System ist nicht perfekt, aber es funktioniert hinreichend gut und möglicherweise besser als andere.
Vor ein paar Jahren, als die Protagonisten und Verfechter der Blockchain – der solution without a problem – nach Problemen suchten, die sie lösen könnten, kamen auch Wahlen in den Blick. Angenehm skeptisch äußerte sich Jesse Dunietz 2018 in einem Beitrag für Scientific American: Are Blockchains the Answer for Secure Elections? Probably Not.
Der Text fokussiert auf die Vereinigten Staaten, wo das Thema der election integrity bekanntlich überaus relevant ist – allerdings, so mein Eindruck, auch wegen des vorherrschenden Einsatzes von Wahlmaschinen. Dunietz: „nearly every electronic voting machine has proved hackable.“ Dem könne mit Blockchain aber kaum begegnet werden. Die rechtlichen und technischen Erfordernisse gingen weit über den Lösungsraum Blockchain hinaus.
Umso verdutzter war ich heute, als ich die in dem Beitrag genannten Start-ups suchte und es die meisten von ihnen noch zu geben scheint; beispielsweise – absichtlich nicht verlinkt: democracy.earth, votem.com, voatz.com. Der USP mag im einen oder anderen Fall ein wenig von Blockchain abgerückt sein, aber versprochen wird weiterhin, Wahlen technisch auf irgendeine Art besser zu machen.
Wie heißt der Gegenbegriff zum Solutionismus?
Solutionismus beschreibt nach Evgeny Morozov eine Denkweise, wonach komplexe gesellschaftliche, politische oder kulturelle Probleme durch technologische Lösungen behoben werden könnten. Dem Begriff verwandt ist der verbreitete Kult um Start-ups und ihre Gründer (Entrepreneure), die stete Suche nach Innovation, der moderne Fortschrittsglaube mit seinem unbedingten Technikfokus, versinnbildlicht im iPhone-Moment und der Suche nach dem nächsten vergleichbaren Moment (vielleicht KI?).
Ich stoße an dieser Stelle – auch in der Auseinandersetzung mit dem leidigen Smart City-Thema – immer auf eine gedankliche Nullstelle, an der mir der richtige Begriff fehlt. Damit meine ich einen Begriff dafür, dass es nicht grundsätzlich schlecht ist, wenn Dinge oder Prozesse mühsam sind, etwa weil sie Material erfordern, das bewegt werden muss, oder weil sie des Einsatzes vieler Menschen bedürfen. Unter Umständen ist die Friktion, ist die Verlangsamung, ist der Aufwand sinnhaft, zweckmäßig und erhaltenswert.