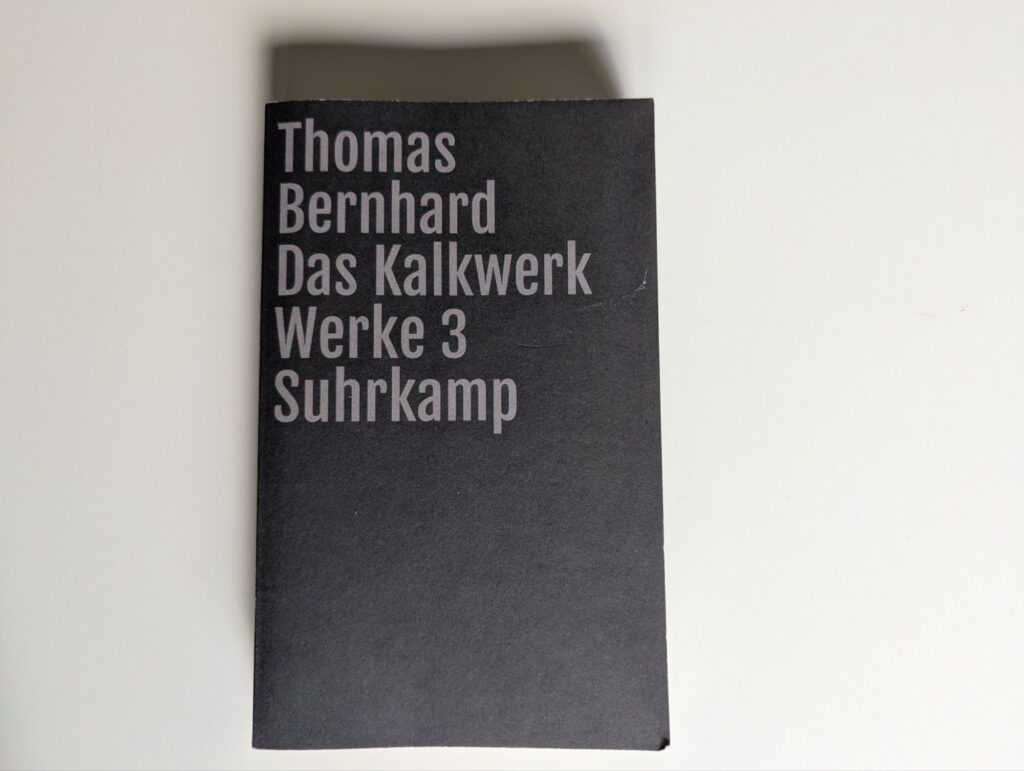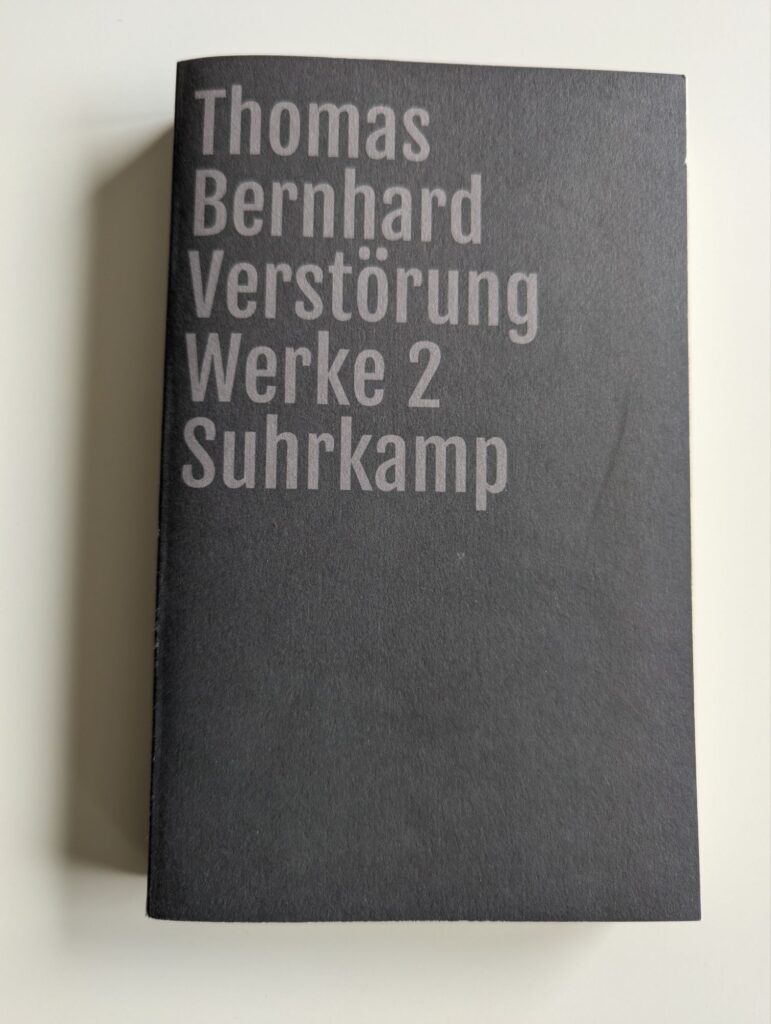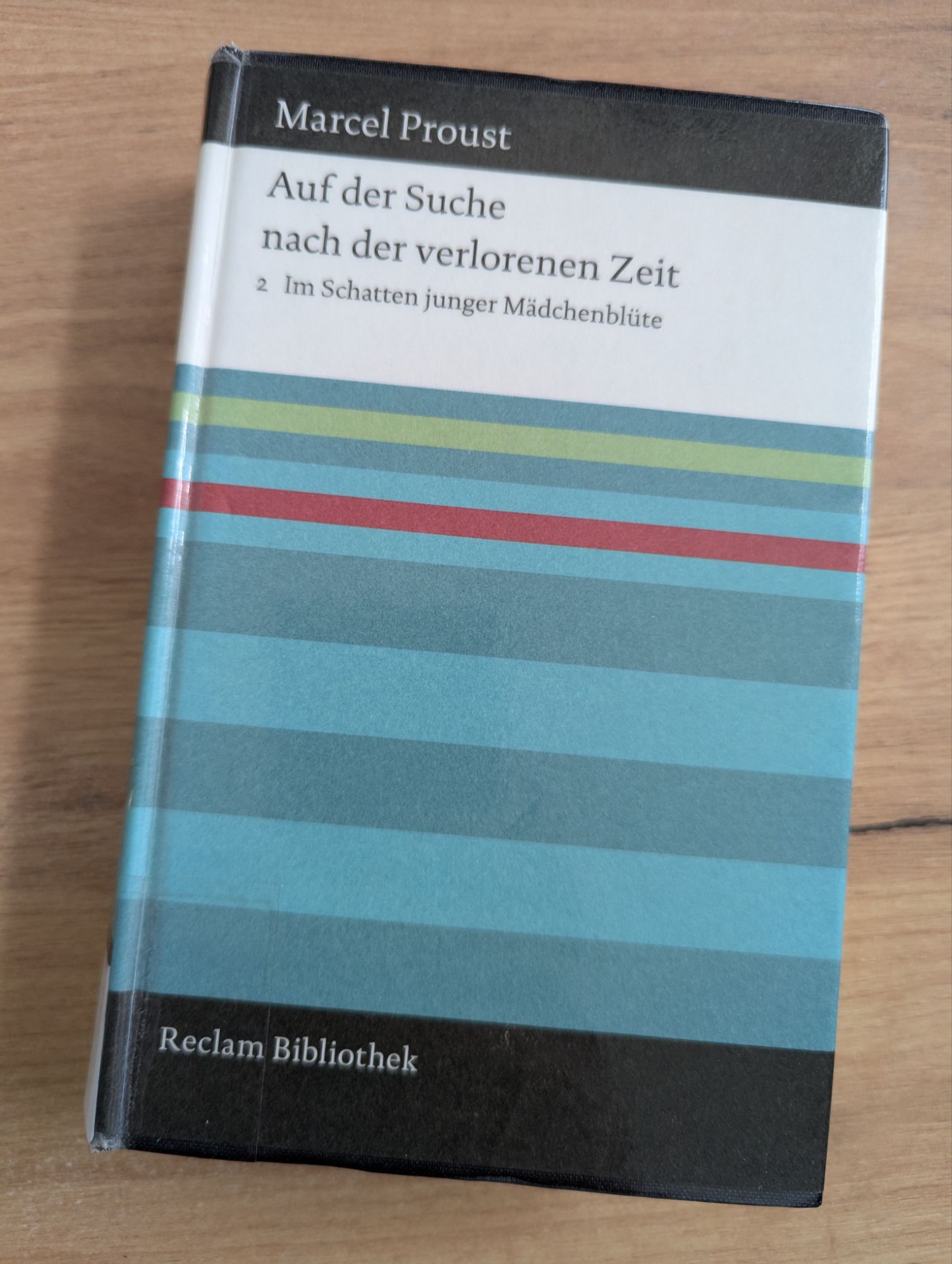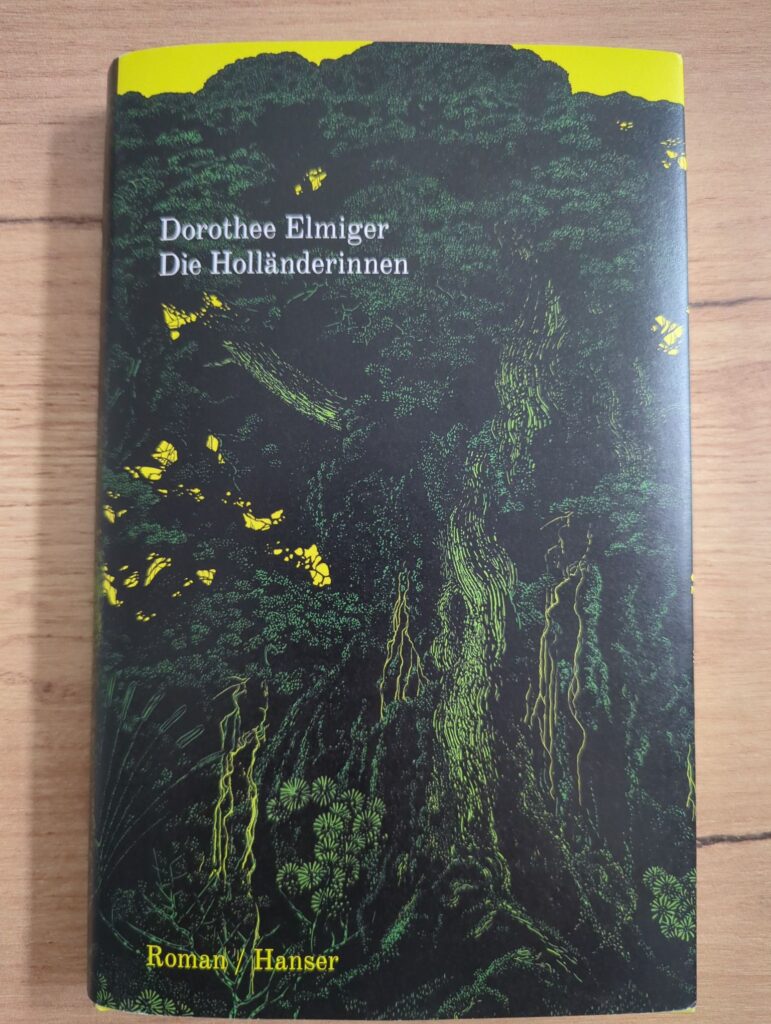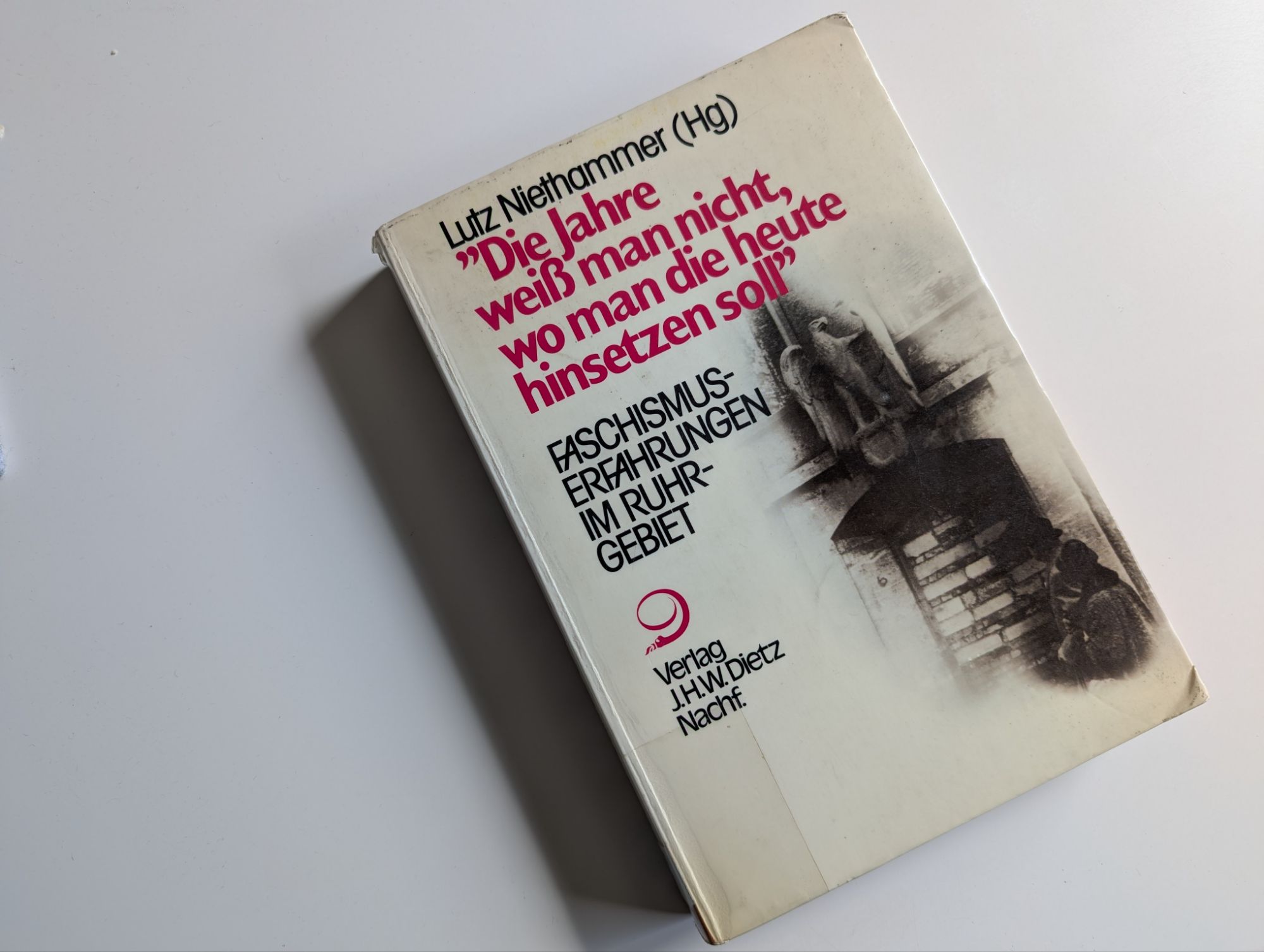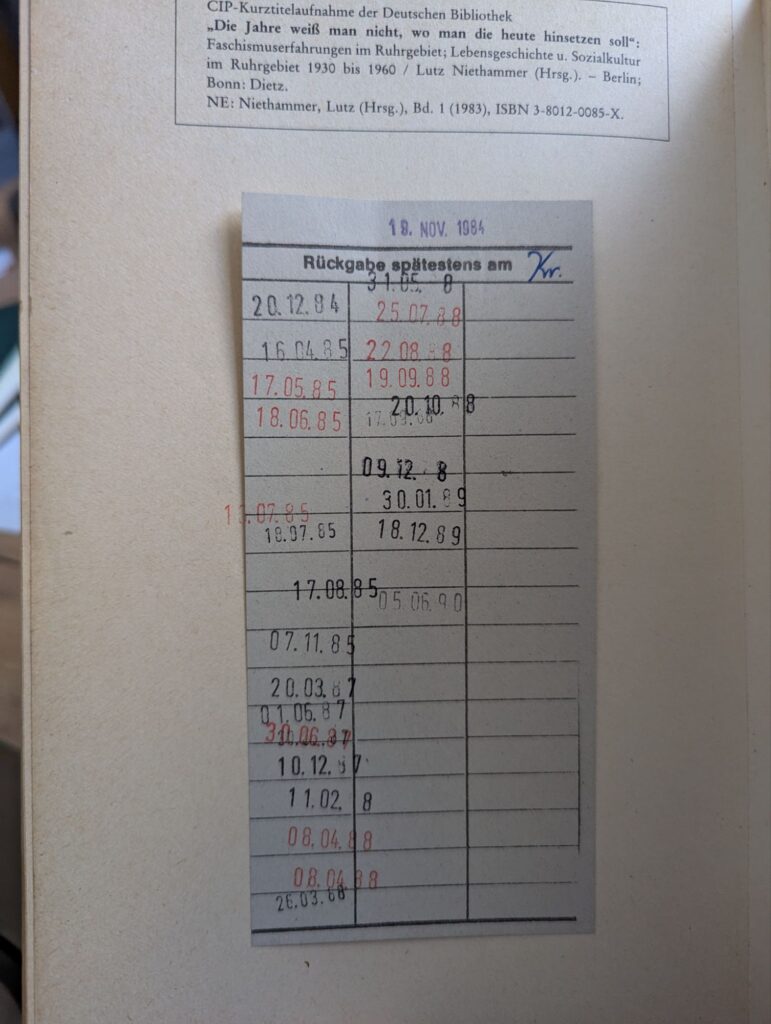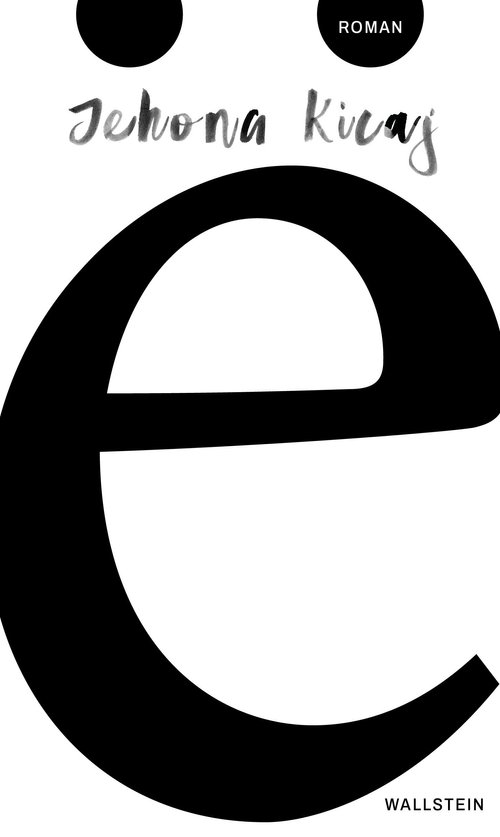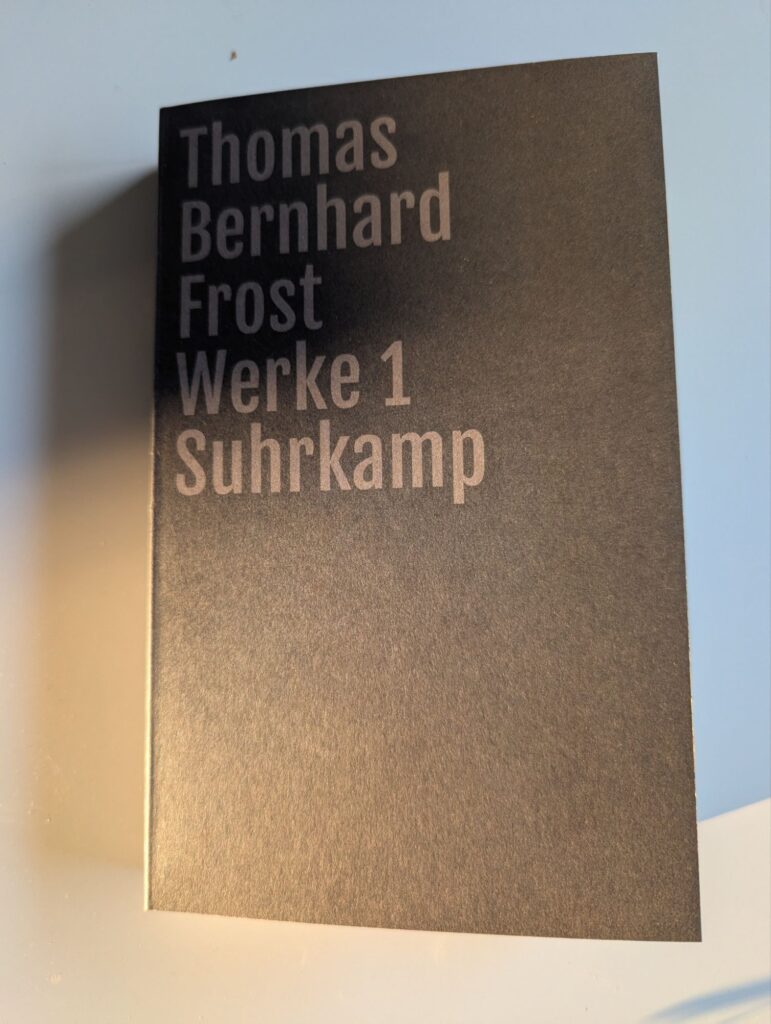Auf Empfehlung vom Couchblog für einen schlanken Fünfer bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt.
Es gibt nicht die Elite im populistischen Sinne, aber es gibt Eliten. In der Elitenforschung der Politikwissenschaft wird ihnen bei der Einführung und Stabilisierung demokratischer Institutionen eine wichtige Rolle zugeschrieben.
Das habe für die Revolutionen und Transitionsprozesse in Mittel- und Osteuropa gegolten und auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland übernahmen demokratisch orientierte Nachkriegseliten die Verantwortung für die Konsolidierung der zweiten deutschen Demokratie.
Das ist meiner persönlichen Meinung nach aber weniger Ausdruck des demokratischen Elements der modernen Demokratie, sondern ihres repräsentativen, denn es handelt sich bei allen modernen Demokratien und repräsentative Demokratien. In welchem Maße damit vor allem in der US-amerikanischen Verfassungsgeschichte zwei eigentlich disparate Prinzipien verheiratet wurden, erklärt Philip Manow sehr gut in ‚(Ent-)Demokratisierung der Demokratie‘.
Demokratische Repräsentation (drehen wir die Begriffe doch einfach um) schafft jedenfalls eine politische Elite, die sich für geraume Zeit heterogon – sowohl aus bürgerlichen wie aus Arbeiterhaushalten – rekrutierte. Die Leistung von Hartmanns Buch besteht vor allem darin, darzustellen, welchen Einfluss diese Herkunft auf politische Haltungen und Auffassungen hat, und wie sich diese Rekrutierung veränderte.
Interessant: Das Buch ist 2019 erschienen und wirkt bereits jetzt, vor allem mit der Würdigung von Jeremy Corbyn und Bernard Sanders, sehr aus der Zeit gefallen. Was inzwischen passiert ist, hat Michael Hobbes (via Garbageday) gut zusammengefasst:
I think we’ll look back on the last decade as a time when social media gave previously marginalized groups the ability to speak directly to elites and, as a result, elites lost their minds.